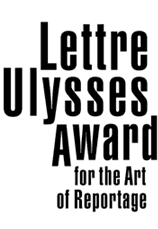
Lettre Ulysses Award Keynote Speech 2005 (German)
Sven Lindqvist
Die Macht der Wahrheit
Rede zum Lettre Ulysses Award 2005, gehalten am 15. Oktober 2005 in Berlin
An einem sonnigen Wintermorgen im Juli, um halb neun, klopfte ich an die Tür des Hauses La Mar 775 in Jauja, einer kleinen Gebirgsstadt in Peru, wegen eines Interviews mit Señor Pablo Landa.
Verschiedenen Quellen zufolge war Landa einer der brutalsten Ausbeuter unter den örtlichen Landbesitzern, und seine Bauern hatten Jahrzehnte lang darum gekämpft, sich aus einer Lage zu befreien, die der Sklaverei nahekam. Ich hatte einiges über die Geschichte des Landguts gelesen, hatte mehrere Bauern interviewt, und da war ich nun, an der Türschwelle ihres Unterdrückers, um nach seiner Version der Geschichte zu fragen.
Es handelte sich eigentlich nur um einen Routinebesuch, einer von Hunderten während einer mehr als ein Jahr dauernden Reportagereise. Er fügte ein paar Teile zu dem großen Puzzle hinzu, das ich von dem Kampf zwischen Landbesitzern und Landlosen in Südamerika zusammensetzte.
Doch das war nicht der einzige Grund, aus dem ich Pablo Landa treffen wollte. Es ging mir auch darum, eine persönliche, beinahe existentielle Neugier zu befriedigen. Wie konnte jemand ein Pablo Landa sein? Wie sah er sich selbst? Die Person, die er selber jeden Morgen im Spiegel sah, mußte von dem Monster, das die Bauern in ihm sahen, sehr verschieden sein. Was für eine Person war er? Das wollte ich herausfinden.
Sich zu entscheiden, wer er sein wollte, fiel ihm schwer, vielleicht weil mein Besuch so unerwartet kam. Er probierte ein Gesicht nach dem anderen.
Mir gegenüber ein Mann von Welt, neigte er dazu, die ganze Angelegenheit auf die leichte Schulter zu nehmen. Eine irritierende Episode, nicht wahr? Aber eine, die doch so überaus alltäglich war in dieser Übergangsepoche, in der sich das alte agrarische Peru in einen modernen Industriestaat verwandelte.
Andererseits hatte er das Gefühl, daß ihm selbst schweres Unrecht getan würde. Eine Bande von illoyalen Indianern, die ihm und seiner Familie alles verdankten, hatte ihn an der Nase herumgeführt. Fünfundzwanzig Jahre seines Lebens waren durch den Streit um ein paar erbärmliche Morgen Land, die er eigentlich überhaupt nicht hatte haben wollen, vergiftet worden.
Es war nicht so einfach, diese verschiedenen Rollen zu einem Bild zusammenzufügen. Einerseits war er bemüht, zu betonen, daß sein Vater und er immer humane Männer gewesen seien – Männer, die niemals von der Hundepeitsche Gebrauch gemacht hätten, der Indianerpeitsche. Andererseits konnte er es nicht lassen, sie mir zu zeigen – sie hing hinter einer Schranktür in seinem Büro, aus Lederriemen geflochten und von einem silbernen Hundekopf gekrönt.
„Die haben meine Vorfahren benützt, um die Indianer bei der Ordnung zu halten. Vor allem meine Onkel, oh ja, bei denen hatten die Indianer eine harte Zeit. Und ich muß sagen: Die Geschichte hat uns gelehrt, daß die Indianer eine dekadente Rasse sind. Nicht, daß sie je so glanzvoll gewesen wären, wie die Archäologen behaupten; aber in jenen Tagen hatten sie wenigstens irgendeine Art von Kultur. Jetzt sind sie nichts als Gangster.“ Und er ließ die Peitsche schnalzen.
Da stand das Monster, vor meinen Augen, gegen das die Bauern von Tingo gekämpft hatten. Mit einem Glucksen hängte der charmante Fünfzigjährige die Peitsche wieder auf und schloß die Schranktür.
Pablo Landa und die anderen Landbesitzer waren es nicht gewohnt, mit Tatsachen und Werten konfrontiert zu werden, die ihre eigenen Werte in Frage stellen. Als die Landas vor einem halben Jahrhundert schwerbewaffnete Polizeikräfte zur Hilfe riefen, um den Streik ihrer „Sklaven“ während der Ernte zu unterdrücken, wurde diese Handlungsweise von jedem, der etwas zu sagen hatte, als angemessen betrachtet. Niemand dachte im Traum daran, die Bauern um ihre Meinung zu fragen.
Die etablierte Presse stand zu dieser Zeit immer auf der Seite der Landbesitzer.
Südamerikanische Zeitungen brachten kaum eine echte Reportage. Interviews, in denen hart zur Sache geredet wurde, Augenzeugenberichte, ganz zu schweigen von den Gedanken und Gefühlen der Augenzeugen, wurden so gut wie nicht gedruckt. Das Bild der Wirklichkeit in der südamerikanischen Presse war von vorne bis hinten aus zweiter Hand. Niemals wurden die Unterdrücker mit ihren Taten konfrontiert.
Es ist wichtig, sich klar zu machen, wie gut sich Pablo Landa vor jeder Beobachtung von außen geschützt fühlte. Als er Manuel Grijalba ins Gefängnis werfen ließ und Canchos Frau bedrohte, als er ihren ältesten Sohn Jauja nahm und ihn für einen Tag ins Gefängnis sperren ließ, als er sechs ihrer Lämmer schlachtete und ihren Hühnern den Hals umdrehte – da dachte er keinen Augenblick lang daran, daß an einem Montagmorgen um halb neun ein ausländischer Besucher mit Werten, die er nicht teilt, vor seiner Tür stehen und nach einer Erklärung für diese Ereignisse verlangen könnte.
Er fühlte sich so sicher, wie man sich nur fühlen kann.
Noch heute fühlen sich die Eigentümer und Herren auf Hunderttausenden südamerikanischen Landgütern nicht weniger sicher vor Beobachtung.
Dieses Gefühl der Sicherheit ist Teil ihrer Macht.
Solange sie das Gefühl haben, daß niemand weiß oder niemand sich darum kümmert, was sie mit ihren Bauern und Arbeitern machen, tun sie, was ihnen gefällt.
So lange sie für das, was sie tun, nicht Rede und Antwort stehen müssen, werden sie fortfahren, es zu tun.
Das trifft nicht nur für Gutsbesitzer zu, sondern für alle Machthaber. Das Wissen, daß niemand hinsieht und Kontrolle ausübt, ist der Boden, auf dem Betrug, Gewalt und Unterdrückung gedeihen.
Das Wissen, daß man beobachtet wird und jederzeit mit den Tatsachen des eigenen Handelns konfrontiert werden kann, hilft der Moralität derer, die die Macht haben, enorm auf die Sprünge.
Darum habe ich die Reportage, insbesondere die investigative, konfrontierende Reportage, zu einer wichtigen Aufgabe meines Lebens gemacht.
*
Wie hat alles angefangen? Es begann, glaube ich, mit einem kleinen Buch mit gelben Seiten, das meiner Großmutter gehörte.Von Zeit zu Zeit plünderte meine Mutter das Zimmer meiner Großmutter und warf „eine ganze Menge Müll“ weg. Ich verstand sehr gut, wie verzweifelt Großmutter war, als der „Müll“ verschwand. Die Versuche meiner Mutter, die Wohnung sauber zu halten, erschienen mir als lieblose Übergriffe, nicht anders als die, denen ich selbst ausgesetzt war. Also wühlte ich zwischen den Kartoffelschalen und den Abfällen im Mülleimer, um Großmutters Sachen zu retten. Ich versteckte sie zwischen meinen eigenen, bis die Gefahr vorbei war und Großmutter ihren Ramsch, ihre Zeitungen und Bücher wiederhaben konnte. Sie rochen wahrscheinlich nicht besser, nachdem sie im Mülleimer gewesen waren, aber immerhin waren sie gerettet.
Unter den Büchern, die ich vor der Zerstörung bewahrt habe, war eines mit dem unschuldigen Titel Im Schatten der Palmen (i) Es erwies sich als das grausamste Buch, das ich je gelesen hatte.
Es war das Tagebuch eines schwedischen Missionars, Edvard Wilhelm Sjöblom. Er trifft im Juli 1892 im Kongo ein und fährt mit einem Dampfer den Kongofluß hinauf, um einen geeigneten Platz für seine Missionsstation zu finden. An Bord sind dreihundert schwarze Jungen, die im Krieg zwischen der Kolonialregierung und den Afrikanern gefangengenommen wurden. Sie werden nun zu einem Lager gebracht, in dem sie zu Kindersoldaten im Dienst der Weißen ausgebildet werden sollen.
Einer von ihnen versucht zu fliehen, aber er wird eingefangen. Er wird an die Dampfmaschine gebunden, dort, wo die Hitze am größten ist. Immer wieder zeigt ihm der Kapitän die Chicotte, die Peitsche aus Nilpferdleder.
„Die Zeit des Leidens kam“, schreibt Sjöblom. Der erste Schlag reißt die Haut am Rücken des Jungen auf, und er schreit wie ein Tier. Dann herrscht Stille. Der Körper ist nur noch ein Stück blutiges Fleisch, das bei jedem Schlag zuckt.
Sjöblom zählt sechzig Peitschenschläge. Dann liegt der Junge da, windet sich in Qualen wie ein Wurm, und jedesmal, wenn der Kapitän oder einer von den Handelsagenten vorbeikommt, geben sie ihm ein paar Tritte.
„Ich mußte das alles schweigend beobachten“, schreibt Sjöblom in seinem Tagebuch.
Beim Abendessen tauscht man Bemerkungen über die Behandlung der Schwarzen aus. „Nur die Peitsche kann die Schwarzen zivilisieren“, sagt man. „Der Beste von ihnen ist nicht zu gut, um zu sterben wie ein Schwein.“
Das war es, was ich in Großmutters Buch las, das ich vor der Zerstörung gerettet habe. Ich las es mit ungeheurem Mitgefühl. Ich bin selbst geschlagen worden. Nicht auf diese Art, natürlich, doch genug, um mich mit dem schwarzen Jungen identifizieren zu können.
Mehr noch identifizierte ich mich mit Sjöblom. Ich wollte so werden wie er. Vielleicht kein Missionar, aber einer, der die Welt bereiste und sie kennenlernte. Ich wollte Zeuge der Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten werden und über sie berichten. Wie Sjöblom wollte ich alarmieren und an die Weltmeinung appellieren.
Sjöbloms Reportagen wurden erstmals in der baptistischen schwedischen Wochenschrift Weckoposten veröffentlicht – nicht gerade ein direkter Weg zur Weltöffentlichkeit. Doch was Sjöblom schrieb, war so sensationell, daß die großen schwedischen Tageszeitungen seine Artikel nachdruckten. Dann wurden sie von Zeitungen in Deutschland, Frankreich und Belgien aufgegriffen. Es waren die ersten Reportagen über den Genozid, der im Kongo König Leopolds stattfand.
Sjöblom schrieb einige seiner Artikel auf Englisch und sandte sie an die Kongo Balolo Mission in London. Im Mai 1897 wurde Sjöblom nach London eingeladen und trat bei einer Versammlung auf, die von der Aborigines Protection Society organisiert wurde.
Mit seinem tiefen Ernst und seiner trockenen, detaillierten und eher pedantischen Redeweise machte Sjöblom großen Eindruck. Sein Zeugnis der Massenmorde im Kongo gelangte auf die Titelseite der Times und erreichte eine breite Öffentlichkeit.
Für mich, den Neunjährigen, wurde Sjöblom ein großer Held. Meine Großmutter bekam ihr Buch nie zurück. Ich behielt es und versteckte es hinter anderen Büchern im Bücherschrank meiner Eltern.
Ich war in einem Alter, in dem man Bücher verschlingt: Jugendbücher, Indianerbücher, Abenteuerbücher jeder Art. Aber als ich Sjöblom las, wurde mir klar, daß dieses Buch anders war als alle anderen. Die anderen waren erfunden, zurechtgemacht. Es waren nur Geschichten. Die Dinge, die da erzählt wurden, waren nie geschehen. Die Menschen, um die es ging, hatten nie existiert.
Natürlich war das die primitive Sicht eines Neunjährigen auf die fiktionale Literatur. Aber auch später im Leben fand ich, daß viele Autoren fiktionaler Literatur versuchen, die Authentizität einer wahren Geschichte zu erlangen, indem sie als Dokumentaristen posieren. Sie geben vor, ihre Fiktion sei das persönliche Tagebuch von jemandem, jemandes Autobiographie oder Reportage. Sie verwenden Namen existierender Straßen und die von Personen des realen Lebens, um glauben zu machen, die Geschichten, die sie erzählen, hätten sich wirklich zugetragen. Dennoch können die meisten von uns diese dokumentarische Einkleidung durchschauen und die Fiktion dahinter erkennen.
Die Reportage besitzt von vornherein eine Wahrhaftigkeit, die die Fiktion mit Hunderten von Tricks zu erzielen versucht, aber niemals ganz erreicht.
Sjöbloms Tagebuch, mit allen seinen Unzulänglichkeiten, war viel machtvoller als alles, was ich zuvor gelesen hatte, denn es handelte von realen Menschen und realen Ereignissen. Dies war die ursprüngliche Erfahrung, die von Anfang an mein eigenes Schreiben bestimmte.
*
Die Macht der Wahrheit ist so geartet, daß sie immer Leugnen provozieren wird. Nach Sjöbloms Auftritt in London nahm König Leopold die Sache selbst in die Hand. Im Juni und Juli 1897 ging er auf eine Leugnungstournee nach London und Stockholm, um Queen Victoria und König Oscar II. zu versichern, daß Sjöbloms Beschuldigungen unbegründet seien.
In Brüssel errichtete er ein Monument des Leugnens: das Königliche Museum für Zentralafrika in Tervuren. Die alte Ausstellung von 1900 wurde noch Jahrzehnte lang gezeigt. Als Kongo 1960 die Unabhängigkeit erlangte, wurde das Wort „Belgisch“ in „Belgisch Kongo“ mit schwarzer Tinte ausgestrichen. Ansonsten blieb alles beim alten. Ein sublimes Leugnen, das sich da niederschlug. Tervuren verharrte im belgischen Bewußtsein als riesiger Dinosaurier, umgeben von versteinertem kolonialem Denken.
Heute, im Jahr 2005, beansprucht das Tervuren-Museum, einen neuen Anfang gemacht zu haben. Ein modernisiertes Museum möchte ein „Zentrum für Zentralafrika-Studien“ werden. Eine neue Ausstellung veranschaulicht die „Erinnerung an die Kolonialzeit im Kongo“. Das wäre eine glänzende Gelegenheit für Belgien gewesen, sich den Verbrechen der Vergangenheit zu stellen und zuzugeben, was mehr als ein Jahrhundert lang verleugnet wurde.
Aber alte Gewohnheiten sind schwer zu durchbrechen.
Das Museum gibt jetzt zu, daß Morde und Massenmorde verübt wurden, betont aber, daß sie nie von den obersten Behörden Belgiens sanktioniert worden seien. Nein, natürlich nicht. Die obersten Behörden ziehen es in jedem Land vor wegzusehen.
Die Zahl der Toten sei weit übertrieben worden, behauptet das Museum. Es gibt keinen Beweis dafür, daß zehn Millionen Afrikaner unter der Herrschaft König Leopolds eines gewaltsamen Todes starben. Vielleicht waren es nur zwei Millionen. Und nicht alle von ihnen sind geradewegs ermordet worden. Ein Teil von ihnen mußte sich zu Tode arbeiten, andere sind verhungert, als das Kolonialregime ihre Nahrungsvorräte und ihre Arbeitskraft requirierte. Aber da sie nicht faktisch ermordet wurden, gab es dem Museum zufolge keinen Völkermord.
Die Ausflüchte und Entschuldigungen sind zahllos. Die furchtbare Wahrheit verschwindet unter den mildernden Umständen. Die Mörder werden nie angeklagt, angeklagt werden diejenigen, die wie ich die Beweise gesammelt und sie der Öffentlichkeit vorgelegt haben. Mein Buch Durch das Herz der Finsternis (ii) wird in der Ausstellung als das beschämende Beispiel schlechthin vorgeführt.
„Die Geschichte der inhumanen Grausamkeiten im Kongo hat eine eigene Gattung entstehen lassen«, behauptet der Katalog. „Prominente Schriftsteller“ servierten uns eine gewaltige Erzählung von europäischer Brutalität. „Die dreistesten und extremsten dieser Schriftsteller versuchen sogar, den Kongo in eine große Geschichte der Barbareien des 20.Jahrhunderts einzureihen, insbesondere in die Geschichte der Massenmorde.“ Das läßt, dem Katalog zufolge, eine neue legenda negra entstehen, eine falsche schwarze Geschichte von Grausamkeiten, die in Wahrheit niemals passiert seien.
Ich muß gestehen, daß ich stolz darauf bin, als der Peitschen-Junge des Museums in Tervuren ausgezeichnet worden zu sein.
Ich bin stolz darauf, Sjöbloms Zeugnis wieder an die internationale Öffentlichkeit gebracht und die Grausamkeiten im Kongo in den Kontext der europäischen Barbarei des 20. Jahrhunderts gestellt zu haben.
Insbesondere bin ich heute Abend stolz, in Ihrer Gesellschaft, liebe Reporter-Kollegen. Wir alle praktizieren eine Kunst der Wahrheit, eine Wahrheitskunst, die sogar nach hundert Jahren noch die Kraft haben wird, heftiges Leugnen zu provozieren.
Aus dem Englischen von Florian Wolfrum
© Foundation Lettre International Award
i Edvard Wilhelm Sjöblom, I palmernas skugga, Göteborg 1907, Neuauflage Stockholm 2003
ii Sven Lindqvist: Durch das Herz der Finsternis. Ein Afrika-Reisender auf den Spuren des europäischen Völkermords, Frankfurt/M., 1999, Campus. Englische Ausgabe: Exterminate All the Brutes, New York/London, 1996, Granta. Schwedische Ausgabe: Utrota varenda jävel, Stockholm, 1992, Bonnier
